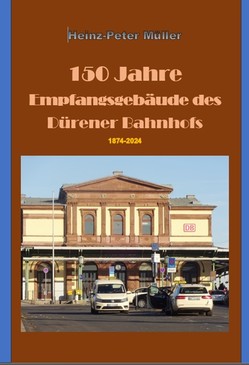Bürgerinformation zum Stand des Wiederaufbaus der Talbahnstrecke in Eschweiler-Aue
Am 26. Juni 2024 ab 18 Uhr fand im ehemaligen Empfangsgebäude des Eschweiler Talbahnhofs eine gut besuchte Infoveranstaltung zum Stand des Wiederaufbaus der Euregiobahn im Abschnitt zwischen dem Hp. Eschweiler-West und Stolberg Hbf statt. Dabei ging es insbesondere um die im Bereich Eschweiler-Aue geplanten Baumaßnahmen.
Thomas Fürpeil als Vertreter der „Euregio Verkehrsschienenetz GmbH“(EVS) und Norbert Reinkober als Vertreter der 2023 geschaffenen „go.Rheinland GmbH“, dem Nachfolger des Nahverkehrszweckverbandes Rheinland (NVR), berichteten über den Stand der Arbeiten zur Beseitigung von Hochwasserschäden am Schienennetz der Städteregion Aachen und gaben einen Ausblick auf die Entwicklung des regionalen Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Mit eindrucksvollen Fotos wurden die im Juli 2021 in Eschweiler-Aue entstandenen und bis heute immer noch nicht beseitigten Schäden an der Stützwand der Bahntrasse zur Inde hin dargestellt. Zusätzlich wurden auch die jüngst sichtbar gewordenen weiteren Schäden gezeigt.
 Hochwasserschäden an der Stützmauer zum Indeufer hin im Bereich der nordöstlichen Ausfahrsignale des Bf. Eschweiler-Aue mit Blickrichtung Indeviadukt (oben und unten).
Hochwasserschäden an der Stützmauer zum Indeufer hin im Bereich der nordöstlichen Ausfahrsignale des Bf. Eschweiler-Aue mit Blickrichtung Indeviadukt (oben und unten).

 Blick auf die in solider genieteter Stahlfachwerk-Bauweise hergestellte alte Indebrücke in Eschweiler-Röhe mit Hochwasserschäden vom 14./15. Juli 2021. Diese Brücke ist bereits durch einen Neubau ersetzt worden, der aber seitdem noch nicht befahren wird und somit bis zur Wiederherstellung der gesamten Talbahnstrecke, d.h. wahrscheinlich bis Ende 2025 oder Ende 2026, eine „Investitionsruine“ bleibt.
Blick auf die in solider genieteter Stahlfachwerk-Bauweise hergestellte alte Indebrücke in Eschweiler-Röhe mit Hochwasserschäden vom 14./15. Juli 2021. Diese Brücke ist bereits durch einen Neubau ersetzt worden, der aber seitdem noch nicht befahren wird und somit bis zur Wiederherstellung der gesamten Talbahnstrecke, d.h. wahrscheinlich bis Ende 2025 oder Ende 2026, eine „Investitionsruine“ bleibt.
 Bilanz und Ausblick – man beachte die bis 2026 reichenden Zeithorizonte für die Inbetriebnahme der Strecke vom Hp. Stolberg-Rathaus zum Bf. Stolberg-Altstadt und die Verlängerung nach Breinig sowie für den „Lückenschluss zwischen Stolberg Hbf und Eschweiler-West.
Bilanz und Ausblick – man beachte die bis 2026 reichenden Zeithorizonte für die Inbetriebnahme der Strecke vom Hp. Stolberg-Rathaus zum Bf. Stolberg-Altstadt und die Verlängerung nach Breinig sowie für den „Lückenschluss zwischen Stolberg Hbf und Eschweiler-West.
Ergänzend wurde u.a. der Bau eines neuen Haltepunktes am Verkehrslandeplatz Würselen-Merzbrück und das Bemühen um die Elektrifizierung von Teilen des EVS-Netzes angesprochen. Die vom Nahverkehrszweckverband „go.Rheinland“ vorgestellten Visionen von einer künftigen zusätzlichen Regionalexpresslinie von Köln über Aachen und Lüttich bis nach Brüssel sorgten in Anbetracht der zwischen Eschweiler und Aachen bestehenden realen Probleme im Bahnverkehr lediglich für Heiterkeit und Sarkasmus.
 Übersicht zu Angebotsverbesserungen: Wer genauer hinschaut wird stutzen. Die umsteigefreie Verbindung von Aachen nach Lüttich ist nicht wirklich neu. Bevor die SNCB der Verbindung nach Spa den Vorzug gab, verkehrten viele Jahre lang durchgehende Nahverkehrszüge („AIXpress“) zwischen Aachen und Lüttich. Hier wird in Wahrheit nur eine Angebotsverschlechterung zurückgenommen. Bemerkenswert ist ebenso, dass für die Elektrifizierung der von der Linie RB 20 genutzten EVS-Strecken und den Einsatz von neuen Triebfahrzeugen auf der Euregiobahn kein Zeithorizont mehr angegeben wird….
Übersicht zu Angebotsverbesserungen: Wer genauer hinschaut wird stutzen. Die umsteigefreie Verbindung von Aachen nach Lüttich ist nicht wirklich neu. Bevor die SNCB der Verbindung nach Spa den Vorzug gab, verkehrten viele Jahre lang durchgehende Nahverkehrszüge („AIXpress“) zwischen Aachen und Lüttich. Hier wird in Wahrheit nur eine Angebotsverschlechterung zurückgenommen. Bemerkenswert ist ebenso, dass für die Elektrifizierung der von der Linie RB 20 genutzten EVS-Strecken und den Einsatz von neuen Triebfahrzeugen auf der Euregiobahn kein Zeithorizont mehr angegeben wird….
Im Anschluss an diese Bürgerinformation stellten sich die Fachleute den Fragen, Anregungen und der Kritik aus der Bürgerschaft. Insbesondere die „go.Rheinland GmbH“, die sich als Motor der Region und Botschafter der Verkehrswende verstanden wissen will und das Ziel proklamiert, gemeinsam mit den anderen Akteuren den Nahverkehr im Rheinland nachhaltig fit für die Zukunft machen zu wollen, wurde in ihrer Funktion als Auftraggeber des Verkehrsangebots auf der Linie RB 20 mit viel Kritik am Verkehrsangebot zwischen Eschweiler und Aachen, an fehlender Kommunikation zwischen Schienenverkehr und Ersatzbussen, an ungenügenden Anschlüssen, an einerseits viel zu langen Übergangs-Wartezeiten am Eschweiler-Talbahnhof und andererseits oft verlorenen Anschlüssen in Stolberg Hbf sowie an fehlenden Fahrgastinformationen konfrontiert.
Die Bürgerschaft zeigte wenig Akzeptanz für die bis mindestens Ende 2025 andauernde Sperrung der RB 20-Strecke zwischen Eschweiler und Stolberg. Aus Sicht der Bürgerschaft ist der angebotene Schienenersatzverkehr weder vom Zeitaufwand noch von der Zuverlässigkeit her geeignet, den offenbar noch jahrelangen Ausfall der Euregiobahnverbindung zwischen Eschweiler Talbahnhof und Stolberg Hbf aufzufangen. „go.Rheinland“ verwies dazu auf Fahrgastzählungen aus einer Woche im März 2024, die –entgegen der Wahrnehmung der Bürgerschaft – nur eine äußerst geringe Frequentierung des Schienenersatzverkehrs zeigte. Mehrfach verwies „go.Rheinland“darauf, dass sich alle beteiligten Akteure seit nunmehr fast drei Jahren stets bemüht haben, für eine Beseitigung der verbliebenen Hochwasserschäden zu sorgen.
Die EVS zeigte sich optimistisch, dass es in den kommenden Monaten gelingen werde, die Instandsetzung der Bahntrasse im Bereich Eschweiler-Aue anzugehen, die erforderlichen Baumaßnahmen durchführen zu können und voraussichtlich bis 2025/2026 dort wieder den durchgehenden Verkehr der Euregiobahn aufzunehmen. Allerdings wurden gleichzeitig schon viele Vorbehalte aufgezählt, die als Ursachen und Begründungen für weitere Verzögerungen stehen können:

Fragen zur Höhe des voraussichtlichen Investitionsvolumens wurden mit dem Verweis, dass es sich um Mittel des Bundes aus der Fluthilfe handeln würde, abgetan und blieben unbeantwortet. Letztlich wird die EVS auch diese Baumaßnahmen an ihrem Streckennetz unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit mit Mitteln des Steuerzahlers finanzieren. In Anbetracht der Haushaltslage des Bundes und dem Sparzwang besteht hier allerdings große Gefahr von Mittelkürzungen. Immerhin hat die Bürgerschaft damit zumindest die Chance, in einigen Jahren wieder eine alltagstaugliche klimafreundliche Verkehrsverbindung nach Aachen zurückzubekommen. Bis dahin wird sie allerdings auch die Möglichkeit zurückbekommen, Aachen bequem über die A 544 und die neue Brücke über das Haarbachtal zu erreichen.